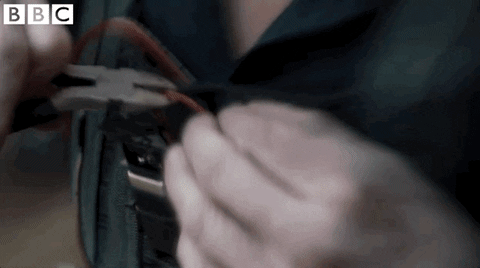Aufgeladene Action, eine mögliche Verschwörung und hanebüchene Szenen und Wendungen: Die sechsteilige Miniserie „Bodyguard“ ist gleichzeitig ein großer Spaß und ein großes Ärgernis. Und das nicht nur wegen Robb Stark aus „Game Of Thrones“.

Seit 24. Oktober 2018 läuft „Bodyguard“ auf Netflix. Nein, nicht die Blockbuster-Schnulze mit Whitney Houston und Kevin Costner aus dem Jahr 1992. Sondern eine gleichnamige britische Mini-Serie aus dem Jahr 2018, die mit ihrem Namenspatron außer des Titels nur die Grundidee gemein hat.
Auch in der BBC-Auftragsproduktion geht es um einen Mann, dessen Beruf es ist, eine Frau zu beschützen. Auch hier kommen sich – Achtung, Spoiler – beide Protagonisten näher. Die zu beschützende Julia Montague (Keeley Hawes) aber ist kein Popstar, sondern britische Innenministerin, die als Hardlinerin potentiellen Terroristen und damit auch der organisierten Kriminalität das Leben schwerer machen will und ein entsprechend wahrscheinliches Attentatsopfer ist. Ihr neuer Leibwächter David Budd (Richard Madden) ist ein traumatisierter und von Frau und Kindern getrennt lebender Kriegsveteran, der seinen Job sehr ernst nimmt. Bis er selbst ins Fadenkreuz gerät: Die Anzeichen verdichten sich, dass er der Innenministerin nicht nur an die Wäsche, sondern auch an die Gurgel wollte. Budd muss jetzt beweisen, dass seine Verschwörungstheorie keine ist und er weiß, wer tatsächlich hinter den passierenden Anschlägen steckt.
Man muss nun wissen: „Bodyguard“ ist die erfolgreichste britische Serie der vergangenen zehn Jahre. Seit „Doctor Who“ 2008 wurde keine Show dort öfter gesehen. Die sechs von Jed Mercurio erdachten Folgen wurden seit dem 26. August 2018 in wöchentlichen Doppelfolgen auf BBC One ausgestrahlt – und das in einem Land, das auch „Sherlock“, „Black Mirror“, „Downton Abbey“, „The Queen“ und das Stromberg-Original „The Office“ hervorbrachte. Die Messlatte hängt also hoch. Umso mehr verwundert, wie schlampig und lückenhaft der Actionthriller geschrieben, gedreht und umgesetzt wurde – und wie spannend seine Episoden gerade zum Finale hin trotzdem um die Ecke kommen.
Warum der UK-Serienhit „Bodyguard“ auf Netflix eine spannende Frechheit ist
Der Hauptdarsteller
Richard Madden gelang als Robb Stark in den ersten drei Staffeln „Game Of Thrones“ zu Weltbekanntheit. In „Bodyguard“ gibt er nun den blank rasierten und emotionslosen Ex-Soldaten, den man schon wegen seines schottischen Akzents stellenweise kaum ernst nehmen kann: Frauen werden von ihm grundsätzlich und nahezu mechanisch mit „Mum“ angeredet, obwohl er „Ma’am“ meint. Zudem sieht er hier aus wie ein spaßbefreiter Halbbruder von Thomas Müller – aber nicht wie der Actionstar, der als nächster James Bond im Gespräch ist.
Die Actionszenen
Das Budget scheint recht ordentlich für eine sechsteilige Fernsehproduktion, wurde mutmaßlich aber leider in Schauspielgagen anstatt in Special Effects gesteckt: Immer dann, wenn Autos, Häuser oder Menschen explodieren, wenn Flammen lodern und Blut spritzt, wirkt „Bodyguard“ nicht wie ein Highclass-Thriller, sondern wie ein besseres „Alarm für Cobra 11“. Oder wie eine Parodie auf sein eigenes Genre.
(Okay, die Szene war doch relativ krass)
Die Logiklücken
In einer Szene entdeckt Sergeant Budd einen Scharfschützen auf dem Dach eines Hochhauses. Um ihn persönlich zu stoppen, stürmt Budd in die Empfangshalle, ruft „I’m a police officer“, zeigt seine Marke – und wird vom Sicherheitspersonal ohne Gegenfragen durchgewunken. Spätestens seit Anders Breiviks Massenmord auf der norwegischen Insel Utøya weiß die Welt aber, dass nicht jedem Mann in Uniform zu trauen ist.
In einer anderen Szene wird der mutmaßliche Attentäter mit Sprengstoffgürtel und „Todmann“-Zünder am Daumen seelenruhig durch London eskortiert. In einem winzigen, von Wohnblocks umringten Park soll er niedergestreckt werden, ohne Evakuierung und nicht ohne die an dieser Stelle doppelt dumme Ansage der Anti-Terror-Chefin: „Wir wissen nicht, welcher Sprengstoff darin steckt und wie stark seine Detonationskraft reicht“.
Eine von diversen weiteren Fragwürdigkeiten stellt der Gebrauch von Funkgeräten in der gleichen Szene dar. Wenn man nicht weiß, wie die Bombe buchstäblich tickt und ob sie vielleicht per Fernzünder gesteuert wird: Ist es da schlau, dem Westenträger zur Kommunikation ein Funkwellen übertragendes und möglicherweise interferierendes Walkie-Talkie in die freie Hand zu drücken?
Und dann gibt es da noch diverse echte Bodyguards, die in britischen Boulevardmedien weitere Ungereimtheiten der Serie aufzeigen. Aber wer ließe sich schon eine spannende Geschichte von der Realität versauen? Eben.
Die Referenzen
„Bodyguard“ ist nicht die erste Serie, in der es um Terrorismus und Inside Jobs geht, es wird auch nicht die letzte gewesen sein. Wer aber mit „24“ die Mutter des Post-9/11-Genres sah, Sutherlands Präsidentenversion „Designated Survivor“ oder „Homeland“ mit Claire Danes, der bingt „Bodyguard“ an zwei Abenden weg – wegen besagter Fahrlässigkeiten und der gleichzeitigen Spannung mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Das Staffelfinale nämlich, das hat es wirklich in sich.
Der Plottwist am Ende
… birgt einerseits eine späte Wendung in einem eigentlich gelösten Fall, ist andererseits nicht wirklich einer – sorgt aber dafür, dass man sich die erste Szene der ersten Folge gleich noch einmal anschauen möchte. Und dafür, dass man auch seine eigene Wahrnehmung von Männern und Frauen, Opfern und Tätern einmal überdenkt. Gibt „Bodyguard“ am Ende gar eine Lehrstunde in fehlgeleitetem Feminismus? Das vermag der männliche Autor dieser Zeilen nicht abschließend zu bewerten.
„Bodyguard“, Staffel 1 seit 28. Oktober 2018 auf Netflix im Stream. Eine zweite Staffel ist noch nicht bestätigt.
Dieser Text erschien zuerst am 8. November 2018 auf musikexpress.de.